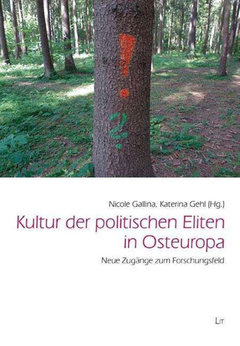Keine Frage: Rumänien und etliche andere Staaten Südosteuropas haben ein gewaltiges Problem mit ihren politischen Eliten. Seit Monaten führt die Dragnea-Truppe in Rumänien vor, was es bedeutet, wenn sich eine politische Führungsschicht als eine Art höchster sakrosankter Kaste statt dienender politischer Klasse missversteht. Nach den von den Staatsparteien bis 1989 unter der Käseglocke von Ideologie und Regime herangezüchteten und streng gesinnungsgefilterten Führungskräften ist nun eine Elite herangereift, die den Staat als Selbstbedienungsladen und politisches Handeln als Gelegenheit zur Selbstbereicherung versteht. Dieses Schicksal teilt Rumänien durchaus mit anderen Transformationsstaaten der Region, auch wenn die institutionellen Rahmenbedingungen häufig zumindest auf dem Papier EU-Anforderungen genügen.
In der politikwissenschaftlichen Forschung kamen die Bedingungen, der Ablauf und die Prozesse der politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Transformation seit 1989 bisher vor allem mit stark auf institutionelle Strukturen fokussierten Theorien und Methoden in den Blick. Ein neuer Band aus dem LIT-Verlag fragt nun gezielt nach der politischen Kultur der Eliten in Osteuropa und plädiert hier höchst überzeugend für einen Paradigmenwechsel oder zumindest eine Ergänzung der politikwissenschaftlichen Perspektive aus der Sicht der Ethnologie und der Sozialanthropologie: Nicole Gallina, Katerina Gehl (Hg.): Kultur der politischen Eliten in Osteuropa. Neue Zugänge zum Forschungsfeld, LIT-Verlag: Wien/Zürich 2016, 264 S., ISBN 978-3-643-80233-0 (Reihe: Freiburger Sozialanthropologische Studien, Band 49), 29,90 Euro.
Schon die Einleitung der beiden Herausgeberinnen Nicole Gallina und Katerina Gehl arbeitet Grundprobleme heraus. Sie betonen die „Grenzen von Theorien und Methoden einer lediglich auf institutionelle und administrative Strukturen gerichteten Forschung (…), die nicht ohne weiteres auf das östliche Europa übertragbar sind“, denn „ein politischer Wandel zieht nicht zwangsläufig einen kulturellen Wandel nach sich“.
Nach Gallina und Gehl „werden die Modernisierungsprozesse (Pluralisierung, Globalisierung, Individualisierung, Demokratisierung), mit denen die Gesellschaften des östlichen Europa nahezu unvorbereitet konfrontiert werden, fast ausschließlich hinsichtlich der politischen und wirtschaftlichen EU-Integration analysiert und entsprechend als defizitär und problematisch interpretiert. Unberücksichtigt bleiben bei dieser vor allem auf die Makroebene gerichteten Perspektive die je eigenen Bedürfnisse, Erfahrungen und Traditionen – der soziokulturelle und historische Kontext also, ohne den die Dynamiken von Wandel und Beharrung (…) nicht angemessen zu verstehen sind.“
Die zwölf Beiträge des Bandes – Grundlagentexte und Fallstudien – kehren nun die bisherige Perspektive um. Die Autoren fragen, auf welche politische Kultur jene „aus Westeuropa importierten bürokratischen und politischen Strukturen“ in Ländern wie Rumänien, Bulgarien oder auch Georgien treffen. Dass dabei über die Institutionen hinaus gerade die Menschen und ihr Handeln in die Mitte rücken, ist nur konsequent. Denn laut den Herausgeberin-nen „tun sich die vorherrschenden Vorstellungen, aber auch die politische Korrektheit in Politik und auch Wissenschaft, schwer damit zu akzeptieren, dass es nicht nur auf den politischen Rahmen und die Institutionen ankommt, sondern auch auf den Menschen und sein Verhalten selbst“.
Die einzelnen Beiträge des Bandes sind hernach für den an Südosteuropa und Rumänien interessierten Leser höchst aufschlussreich. Programmatische Wegmarken setzen dabei Klaus Roth („Politische Kultur und Kultur der politischen Eliten im östlichen Europa als Forschungsfeld der Ethnowissenschaften“) und Christian Giordano („Politische Kultur im Plural. Ein Versuch, dem okzidentalen Ethnozentrismus zu entgehen“).
Roth betont, dass „anders als in den Staaten Westeuropas mit ihren entwickelten Demokratien im (süd-)östlichen Europa das historische Erbe von Jahrhunderten Fremdherrschaft und Jahrzehnten kommunistischer Herrschaft die gesamte Alltagskultur und damit auch – bis in die Gegenwart – die politische Kultur und die Kultur der politischen Eliten“ präge. So treffen „regionale politische Traditionen und Kulturen auf universalistisch konzipierte, realiter aus der westeuropäischen Geschichte erwachsene Strukturen, mit denen sie nicht selten inkompatibel sind“. Daher gelte es grundsätzlich die Spezifik der Entwicklung dieser Länder zu berücksichtigen und nicht einseitig mit einem westlichen Begriff von ziviler Kultur zu operieren.
Hätte sich die westliche politische Kultur als Partizipation und Ausgleich zwischen Regierten und Regierenden entwickelt, so sei für die südosteuropäischen Völker im Osmanischen Reich aufgrund historischer Erfahrungen ein scharfer Gegensatz zwischen Untertanen und (Fremd)Herrschern prägend geworden als einer „Herrschafts- und Verwaltungselite“, die meistens nicht ihre Sprache sprach und kulturell wie religiös fremd war. Das Misstrauen gegenüber der osmanischen Herrschaft übertrug sich nach der Nationsbildung auch auf die neue politische Klasse, die zu ihrem Machterhalt die „gewohnten Institutionen des Familismus, Klientelismus und der Patronage“ noch ausweiteten, auch wenn Herrscher und Wahlvolk dann Sprache, Religion, Werte und Normen teilten. Der Missbrauch von Macht prägte Länder und Gesellschaften auch in der kommunistischen Nomenklatura.
Diese Erkenntnisse könnten „anders als das normative Modell der klassischen Politologie, das ‚politische Kultur‘ mit civic culture im Sinne westlicher Demokratie gleichsetzt und dazu neigt, nur Defizite festzustellen – den Blick öffnen für alternative Formen politischer Kultur und zu dessen Verstehen sowie auch zum angemessenen Umgang mit ihnen beitragen“.
Gegen eine westliche Einteilung der Welt in tugendhafte und lasterhafte Gesellschaften und eine „Defizittheorie“ nach dem Motto „the West and the Rest“ wendet sich auch Christian Giordano. Er stellt fest: „Wenn man also mit einer politischen Kultur konfrontiert ist, die uns als Nachfahren der Aufklärung als fremd, abnorm oder sogar inexistent erscheint, dann sollte man zunächst nicht den Fehler begehen, normative Vergleiche mit der civic culture angelsächsischer Provenienz oder ähnlicher Erscheinungen westlicher Provenienz ziehen zu wollen. Vielmehr sollte man sich fragen, welche soziale Logik solchen Phänomenen zugrunde liegt.“
In Südosteuropa herrsche eine scharfe Trennung zwischen öffentlichem und privatem Raum und abgrundtiefes Misstrauen gegenüber Justiz und Politik, die als „Instrument zur persönlichen Bereicherung parasitärer Staatsvertreter“ und als „generalisiertes Patronagesystem“ wahrgenommen werden. Es bestehe eine tiefe Kluft zwischen Staat und Gesellschaft, die auch die Kultur präge. Politische Macht und staatliche Herrschaft gelten als fraglos gegeben und zugleich als korrupt. Nachdem die Erfahrungen der Gegenwart die Einschätzungen der Vergangenheit noch bestätigen, komme es zu entsprechender Ablehnung des Politischen, was weder als Fatalismus, noch als Passivität noch als Rückständigkeit zu interpretieren sei. Die politische Entwicklung und „Teleormanisierung“ Rumäniens vor allem seit den letzten Parlamentswahlen bestätigt seine Thesen.
Die weiteren Beiträge des Bandes zeigen exemplarisch bis grundsätzlich auf, worin nun die Besonderheiten der politischen Kultur und ihrer Eliten in Ost- und Südosteuropa liegen. Dabei beschäftigt sich Nicolas Hayoz mit dem „Syndrom der Machtkultur in Osteuropa“, Nicole Gallina mit der Rolle der Politischen Korrektheit, die in den Transformationsstaaten noch nicht angekommen ist und wohl auch nie in der westlichen Form ankommen wird. Anton Sterbling beleuchtet Elitenkonfigurationen am Beispiel des postkommunistischen Rumänien. Wobei er bei allem Richtigen, was er schreibt, doch entgegen dem Ansatz des Buches eine klassische Defizitdiagnose abliefert und positive zivile Bewegungen wie den erfolgreichen Widerstand der Zivilgesellschaft etwa gegen den geplanten „Dracula-Park“ bei Sighi{oara und das Goldabbauprojekt in Ro{ia Montan² leider ausblendet.
Sonja Schüler stellt an Bulgarien enttäuschte Erwartungen an die Demokratie dar, insofern Politik grundsätzlich als „schmutziges Geschäft“ wahrgenommen werde. Sie beschreibt treffsicher den Typus des „politischen Parvenüs“, der fehlende Professionalität durch arrogante Selbstdarstellung und Statussymbole, Klientel- und Korruptionsnetzwerke kompensiere. Ähnlich argumentiert Ana Luleva in ihrem Beitrag über die Selbstpräsentation der bulgarischen Eliten. Dies treibe Blüten bis hin zu dem Bodyguard-Ministerpräsidenten Borisov mit seiner „Macho-Männlichkeit“. Christian Smigiel beschreibt die Ergebnisse der „Transformation“ zutreffend als „Neoliberalisierung“ und thematisiert besonders die geschlossenen und bewachten Wohnkomplexe, wie sie auch in Bukarest entstanden sind.
Der Band bietet allen, die sich in Wissenschaft und Politik, Medien und Publizistik mit der Region Südosteuropa beschäftigen, erhellende Einsichten. Doch was kann der Leser hier als Fazit ziehen? Verzweiflung oder besseres Verständnis? Klar ist, dass das formell stimmige institutionelle Design der neuen Demokratien noch nicht zu einer Verinnerlichung westlicher Werte geführt hat, dass diese Werte aber auch nicht einfach verordnet werden können und sich mit eigenen Traditionen auch durchaus reiben. An der ideologischen Erziehung ganzer Völker freilich ist schon der Kommunismus gescheitert. Da war die Political-Correctness-Industrie im Westen erfolgreicher.
Wer freilich bejaht, dass in Europa nach 1989 wieder zusammengewachsen ist, was wirklich zusammengehört, kann nicht umhin, diesen politischen und gesellschaftlichen Prozessen mit Geduld zu begegnen. Der materialreiche Band wirbt mit seinen tiefschürfenden Analysen und Fallbeispielen bei aller berechtigten Kritik an Fehlentwicklungen und Defiziten dafür, Analyse und Diskurs all dieser Phänomene trotzdem nicht von einer Position moralischer Überlegenheit aus zu gestalten. Denn das greift zu kurz.