„Vergessen Sie nicht, meine Dame, meine Muttersprache ist Deutsch. Die Sprache ist die Seele des Menschen, und sie ist mein Instrument“, erklärt der Schriftsteller Karl König in dem Roman „Meine Eltern“ von Aharon Appelfeld einer Frau, die von ihm wissen will, warum er nicht zusammen mit den Eltern nach Amerika ausgewandert sei. Die Szene spielt sich 1938 am Ufer des Pruth im nördlichen Teil der Bukowina ab, der damals zu Rumänien gehörte. Appelfeld, in Jadowa bei Czernowitz geboren, sagte ein halbes Jahrhundert später in einem Gespräch mit dem amerikanischen Schriftsteller Philip Roth auf die Frage, welches Verhältnis er zu der Literatur Franz Kafkas habe, dieser habe in Appelfelds Muttersprache, Deutsch, zu ihm gesprochen. Es sei jedoch nicht das Deutsch der Deutschen sondern das Deutsch des Habsburger Imperiums gewesen, das Deutsch Wiens, Prags und Czernowitz’, an dessen besonderem Ton die Juden hart gearbeitet hätten.
Geschrieben hat Appelfeld, der bis zu seinem Tod Anfang dieses Jahres mehr als 40 Bücher veröffentlichte, allerdings in Hebräisch. Denkt man an andere, ebenfalls in der Bukowina geborene Autoren älterer Generationen, wie es Rose Ausländer, Paul Celan, Alfred Kittner, Alfred Margul-Sperber oder Moses Rosenkrantz waren, so mag man einwenden, dass manche noch in dem Kronland der Habsburger Monarchie zur Schule gingen und dass das Deutsche die Sprache der gebildeten Schicht der dort lebenden jüdischen Minderheit war. Appelfeld, dessen Vorname ursprünglich Erwin lautete, hatte jedoch kaum Gelegenheit, die Schule zu besuchen, er war nicht einmal zehn Jahre alt, als er aus einem Todeslager in der Ukraine flüchtete. Als Vierzehnjähriger gelangte er 1946 nach Israel. Seine Eltern sprachen untereinander und mit ihm Deutsch, erzählte Appelfeld vor Jahren dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Und: „Deutsch bedeutete für den assimilierten Juden mehr als nur eine Frage der Kommunikation. Die deutsche Sprache war seine Kultur, ja seine neue Religion.“
„Meine Eltern“, Ende des vergangenen Jahres in deutscher Übersetzung erschienen, erzählt von einem einzigen Sommermonat in einem rumänischen Dorf am Pruth, wo sich die jüdischen Bewohner der Region einmieten und Ferien machen. Man liegt am Ufer in der Sonne, schwimmt im Fluss, wobei die gebildeten unter ihnen, zu denen auch Appelfelds Eltern zählen, die nicht als Ostjuden gelten wollen, zu den anderen, die Jiddisch sprechen, Abstand halten. Insbesondere der Vater, ein erfolgreicher Fabrikant, der sich vom Glauben emanzipiert hat, spart nicht mit kritischen Worten am Verhalten der weniger gebildeten Gäste, die trinken und laut sind, während die Mutter, eine Frau mit Herzensgüte und Phantasie, für vieles mitfühlendes Verständnis zeigt und zu allen Zugang findet. Man verkehrt mit einem Arzt aus der nahen Stadt, mit dem Schriftsteller König, eine Kindheitsbekanntschaft des Vaters kehrt aus Wien endgültig zurück, die Mutter lädt des öfteren ihre Jugendfreundin, die schöne Gusta, zum Abendessen ein.
Weil man das Jahr 1938 schreibt, kommen selbst unter den unbeschwerten Feriengästen Vermutungen auf, dass ein großer Krieg bevorstehen könnte. Doch man wiegelt ab: Die hohe deutsche Kultur werde sich nicht von einem Diktator beherrschen lassen, heißt es etwa. Die Barbarei gehöre zum Osten, während Selbstbeherrschung die westliche Kultur leite. Doch eines Tages fallen Bauern, die an einer Prozession für Regen teilnehmen, über die Gäste her, verfluchen und verprügeln sie. Einige retten sich in den Fluss, andere bekommen schlimme Schläge ab. Der Arzt und ein Sanitäter versorgen die Opfer des „winzigen Pogroms“. Doch niemand packt die Koffer, der Vorfall wird kleingeredet und gilt schließlich als ebenso unvermeidlich wie ein sommerliches Unwetter.
Appelfeld erzählt das alles aus der Perspektive eines Kindes, die er zu Beginn des Buchs programmatisch erläutert. Die schöpferische Arbeit, schreibt er, brauche den Blick des Kindes. Im Laufe seines Schreibens sei er immer wieder in das Haus seiner Eltern und in das Haus seiner Großeltern zurückgekehrt. „Denn die Häuser meiner Eltern und meiner Großeltern sind fast immer um mich, obwohl es sie schon lange nicht mehr gibt. Dies sind meine festen Orte, die ich immer um mich spüre, die ich aufleben lasse…“ Zugleich unterstreicht der Autor jedoch, dass er keine Erinnerungsliteratur schreibe, weil das Bewahren und Festhalten von Erinnerungen ein antikünstlerischer Ansatz sei. Und an anderer Stelle: „Bilder aus der Kindheit aufzurufen, ist immer schmerzlich, besonders was die Menschen von damals betrifft, und umso mehr, als meine Eltern und die, die ihnen nahestanden, nicht wussten, was sie erwartete.“
Bedenkt man, wie kurz diese Kindheit in der Bukowina war, auf deren Erinnerungen Appelfeld seine Kunst baut, ist der Reichtum der Wahrnehmungen und Erfahrungen sehr beeindruckend. Eine andere Perspektive, die des wissenden Erwachsenen, hätte ihm den Zugang zu jenen Jahren vermutlich versperrt. Doch dieser Vorgang zählt zu den Geheimnissen des schöpferischen Prozesses. Der kleine Erwin lauscht den Gesprächen seiner Eltern und der Erwachsenen, soweit er ihnen folgen kann. Er beobachtet, stellt Fragen, kämpft mit schweren Träumen. Die kindliche Sicht ermöglicht es dem Autor auch, den historischen Rahmen völlig auszusparen. Außer dem Namen des Flusses Pruth werden keine Orte genannt, auch das heute ukrainische Czernowitz nicht, man kehrt nach den Ferien „in die Stadt“ zurück. Weil sich die zeitgeschichtliche Kulisse mit den an den Juden der Bukowina während des Zweiten Weltkriegs von deutschen und rumänischen Truppen verübten Verbrechen aber vor dem inneren Auge des Lesers aufbaut, wirkt die Stimme des Erzählers umso gewaltiger.
Die Mutter Appelfelds wurde vor dem Haus der Großeltern erschossen und der Junge im Ghetto von dem Vater getrennt. Der kleine Erwin fand nach der Flucht aus dem Lager in einem ukrainischen Dorf bei einer Prostituierten Schutz, für die er, noch nicht einmal zehn Jahre alt, den Haushalt führte. In „Meine Eltern“ gibt es unter den Sommergästen eine hübsche, fortwährend unter Liebeskummer leidende junge Frau, die von den anderen Gästen zur Außenseiterin gemacht wird und die, einfühlsam beschrieben, als literarische Figur an jene Prostituierte angelehnt sein könnte. Großen Raum nehmen die Gespräche darüber ein, was es bedeutet, Jude zu sein. Karl König erklärt, warum sein schriftstellerisches Interesse insbesondere den Juden gilt und dass er als Jude ohne andere Juden verloren sei. Der Vater mag nur die empfindsamen und sensiblen unter ihnen, der rumänische Bauer, dessen Hütte die Familie gemietet hat, misstraut den Juden und wirft ihnen vor, ihrem Glauben untreu geworden zu sein.
Die jüdische Bevölkerung wird dazu gedrängt, sich zu hinterfragen, weil ihre Bedrohung mit jedem Tag zunimmt und weil die zunehmend nationalistisch und antisemitisch eingestellte Mehrheitsbevölkerung ihr den Platz in der immer noch multiethnischen Gesellschaft streitig macht. Die Angst vor einem Krieg wächst, man erwägt, in den Westen Europas auszuwandern, um den Fehler der vorigen Generation nicht zu wiederholen, die sich in dem letzten Krieg zu spät dazu entschloss. Trotzdem lässt der Autor den Roman nicht mit einer Katastrophe sondern nahezu märchenhaft enden: Ein wohlhabender Kaufmann stirbt und verfügt in seinem Testament, dass sein viel größer als angenommenes Vermögen den Armen, Kranken und Bedürftigen zugute kommen soll. Obdachlose und unglückliche Juden soll es künftig nicht mehr geben. Die Realität des Holocaust, die in der Geschichte der Bukowina und ganz Europas nur kurz darauf folgte, bezeichnete Appelfeld in dem erwähnten Gespräch mit Philip Roth zu recht als etwas, das jede Vorstellungskraft überschritt.

Seine Muttersprache war das habsburgische Deutsch der Juden aus Czernowitz
Zu dem Roman „Meine Eltern“ von Aharon Appelfeld
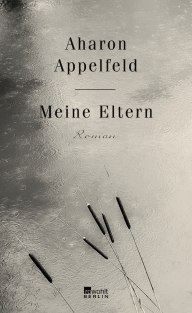
Aharon Appelfeld: „Meine Eltern“, Roman; Aus dem Hebräischen von Mirjam Pressler, Rowohlt Berlin; 272 Seiten; 22,95 Euro




